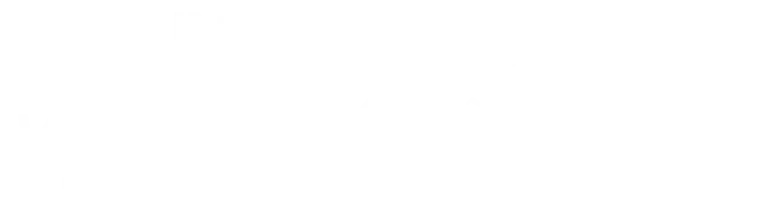Bei der Auftaktveranstaltung der Kommunikationsinitiative ZUKUNFT NAHVERKEHR trafen sich auf dem Wirtschaftsgipfel der „Süddeutschen Zeitung“ Praktiker und Forschende, um über die Mobilität und den ÖPNV von morgen zu diskutieren. Zusammen mit dem SZ Institut hat die Initiative den ZNV Denkraum25 geschaffen. Das Ziel: Fragen rund um das Thema Mobilität sammeln und neue Antworten darauf finden.
Als Moderator und SZ-Institut-Direktor Dirk von Gehlen im Berliner Adlon die Diskussion eröffnete, ließen sich die knapp 60 Gäste nicht lange bitten: Viele von ihnen hatten Fragen zur Auftaktveranstaltung der Initiative ZUKUNFT NAHVERKEHR mitgebracht, die im Rahmen des Denkraum25 erörtern werden können.
Eines wurde dabei schnell klar: Alle teilen die Kernüberzeugung, dass Mobilität ein Grundbedürfnis ist und dass ein gut gestalteter öffentlicher Nahverkehr Vorteile für alle Menschen in Deutschland hat: Er schafft Zugang zu Arbeit, Bildung und Versorgung und sorgt für Platz, wenn weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind. Der ÖPNV trägt zum Klimaschutz bei und hat einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Menschen, denn rund ein Drittel aller Mikroplastikemissionen wird durch den Abrieb von Autoreifen erzeugt. Und auch die Wirtschaft profitiert: „Der ÖPNV könnte die einzige Branche sein, deren Wertschöpfung außerhalb ihrer Branche größer ist als in der eigenen“ – diese These stellte ZUKUNFT NAHVERKEHR Initiator Philipp Kühn zu Beginn der Veranstaltung auf. Ob das wirklich so ist, könnte im Denkraum gemeinsam erörtert werden. Gut eine Stunde diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend, wie sich der ÖPNV verbessern lässt.

So warf Hilmar von Lojewski, Beigeordneter des Deutschen Städtetags und Leiter des Dezernats „Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Verkehr“ im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, die Frage in den Raum, wie wir öffentliche Mobilität in Zukunft finanzieren wollen. Und er brachte auch gleich einen Vorschlag mit: „Wir müssen den öffentlichen Verkehr über den Individualverkehr finanzieren und eine umfassende Straßennutzungsgebühr einführen. Konkret heißt das: Wenn ich zu Stoßzeiten eine Hauptverkehrsader nutzen will, ist das teurer, als wenn ich dieselbe Strecke in einer Randzeit nutze.“ Von Lojewski ist überzeugt, dass wir damit auch eine Antistaugebühr erschaffen, weil die Menschen eher darüber nachdenken werden, ob sie eine Strecke nicht auch mit dem öffentlichen Nahverkehr zurücklegen können.
Hans-Peter Kleebinder, unabhängiger Mobilitätsexperte und Studienleiter an der Universität St. Gallen, bewegt unter anderem die Frage, wie wir es schaffen können, dass Menschen öffentliche Mobilität als etwas Freudvolles wahrnehmen. „Die Automobilindustrie hat das perfekt geschafft, denken Sie nur an Werbeslogan ‚Freude am Fahren‘. Diesen Spirit brauchen wir auch für den ÖPNV.“
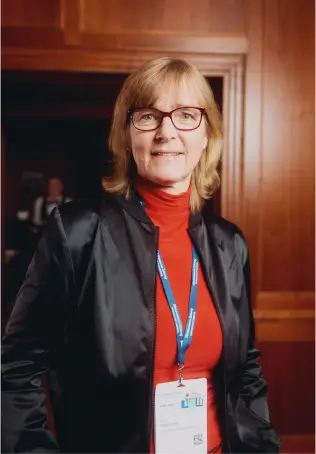

Ähnlich sieht das Iris Hegemann vom Deutschen Tourismusverband. Sie betonte, dass Tourismus ohne öffentlichen Nahverkehr gar nicht möglich sei. Ein Großteil der Touristen nutze insbesondere in den Ballungszentren die öffentlichen Verkehrsmittel, um Sehenswürdigkeiten zu erkunden. „Dass wir alle uns einen besseren Nahverkehr wünschen, ist klar“, so Hegemann. „Ich stelle mir aber die Frage, wie wir endlich in die konkrete Umsetzung kommen.“
An Ideen für diese Umsetzung und zu der Frage „Wie können wir Menschen stärker für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs sensibilisieren“ forscht unter anderem Oliver May-Beckmann, Geschäftsführer von MCube, Münchens Cluster für Mobilitätsinnovationen. Sein Team hat gerade einen Prototyp für den sogenannten Mobi-Score entwickelt, einen Onlinerechner, mit dem Menschen unter anderem einen Kostenvergleich zwischen verschiedenen Mobilitätsformen vornehmen können. Und er betonte: „Mobilität ist schließlich entscheidend dafür, dass wir alle produktiv sein können.“


Dass es hierfür häufig auf den Mobilitätsmix ankommt, war Timm Fuchs besonders wichtig. Fuchs ist als Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund unter anderem zuständig für das Thema Verkehr. Er sagt: „Wir müssen in Mobilitätsketten denken, um den Verkehr der Zukunft attraktiv zu machen. Wir sollten uns also fragen: Wie kann ich die Bus- oder Bahnfahrt beispielsweise mit einer kurzen Fahrt auf einem Miet-Rad kombinieren, um den letzten Kilometer meiner Strecke zurückzulegen?“ Fuchs ist überzeugt: Nur mit einem integrierten Ansatz kann der Nahverkehr der Zukunft für die Menschen attraktiv werden.
Und so wie auf dem gesamten SZ Wirtschaftsgipfel angesichts politisch und wirtschaftlich herausfordernder Zeiten ein Gefühl der Aufbruchsstimmung herrschte, ging auch die Auftaktveranstaltung der Initiative ZUKUNFT NAHVERKEHR mit einem Appell von Initiator Philipp Kühn zu Ende: „Wir sollten gemeinsam dafür sorgen, dass Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sich besser vernetzen, um den öffentlichen Diskurs um die Mobilität der Zukunft zu gestalten.“
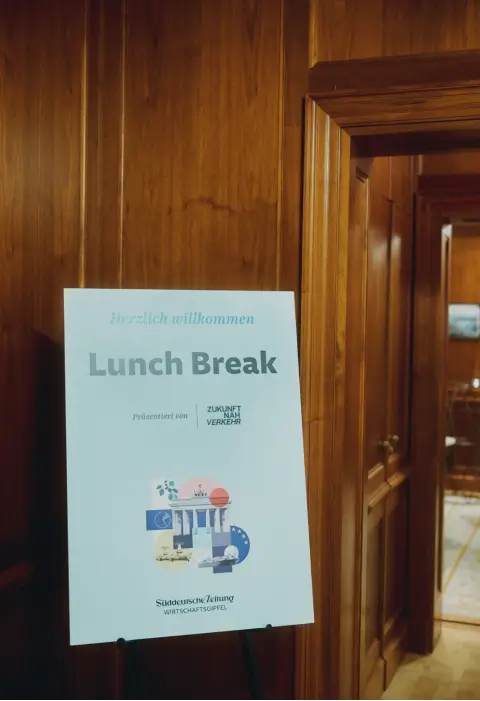

Noch bis zum Herbst 2025 will die Initiative Fragen rund um die Zukunft der Mobilität sammeln und sich gemeinsam mit Expertinnen und Experten auf die Suche nach Antworten machen. Wer mitmachen möchte, kann sich hier anmelden. Außerdem gibt die Initiative einen Newsletter heraus, den Interessierte hier abonnieren können: zukunftnahverkehr.de/denkraum